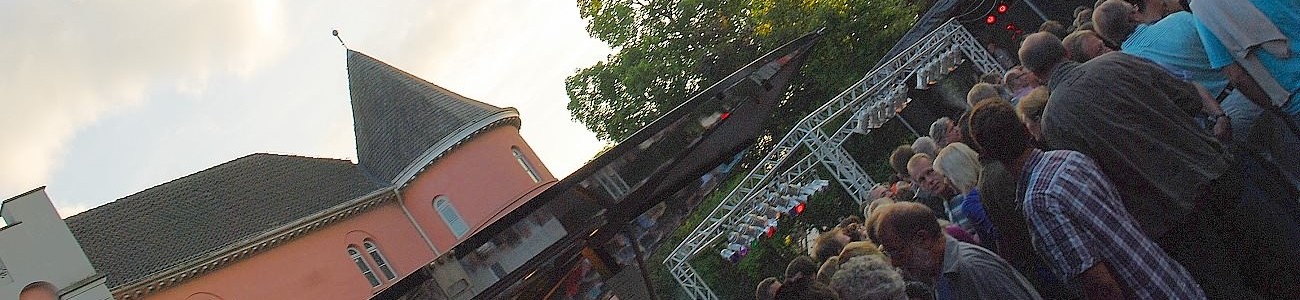Rockmusik kann zuweilen äußerst nervig sein: (zu) laut, pathetisch, voller Posen und Klischees. Wenn man noch die Musikindustrie hinzunimmt, die von jedem Song verlangt, dass er neu, aufregend und stets so klingen muss, dass ein kleines Schildchen im Plattenladen davor stehen kann, dann könnte einem um die Rockmusik angst und bange werden.
Muss es aber nicht. Dafür sorg(t)en bis heute Musiker bzw. Typen wie der gerade verstorbene J. J. Cale, der mit dem ganzen Musikgeschäft wenig bis gar nichts zu tun haben wollte und dennoch einen unschätzbaren Beitrag zur Geschichte der Rockmusik geleistet hat. Gerade jetzt, in der (möglichen) Götterdämmerung der Rockmusik, wird dies besonders deutlich. Eric Pfeil schreibt dazu in seinem Beitrag „Jugend ohne Pop: eine melancholische Vision“ ↑ für den deutschsprachigen Rolling Stone:
„Ist Pop nicht entsetzlich fad geworden? Muss Musik denn überhaupt ‚relevant sein‘ – reichen Charakter und Persönlichkeit nicht aus [ … ] Was soll die arme Tante Pop denn noch alles mitmachen? Womöglich ist Pop, wie es ein Freund mal formulierte, einfach so etwas wie Kirchendeckenmalerei: Hatte mal eine Glanzzeit, ist aber inzwischen vorbei, schön bleibt’s trotzdem.
Vorschlag: Belassen wir es doch einfach mal beim Musikhören. Früher sollte Musik eigentlich nur glücklich machen, dann kam der ganze Unfug mit der Rebellion und der Jugendkultur dazwischen. Um die kommt man vermutlich nicht ganz herum, das sehe ich wohl ein, aber womöglich funktionieren Jugendkultur und Rebellion ja auch ohne Popmusik. Man könnte es ja mal ausprobieren. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich bin froh, dass mein verhaltenes gesellschaftliches Aufmucken noch zu den Klängen von seltsam zusammengekramter Musik stattfinden konnte. Aber könnte es nicht sein, dass die große Chance der knospenden Jugend darin besteht, sich als Katalysator etwas Neues suchen zu müssen anstatt weiter auf dürre Elektroheinis oder lärmende Gitarrenburschen zu setzen?
Aber ich habe gut reden. Ich bin ein alter Mann, ich höre ohnehin nur noch Musik von früher. Und noch nicht mal die nach Mehrheitsmeinung relevanteste. Vielleicht habe ich deswegen in den letzten Jahren den gerade verstorbenen J.J. Cale so gemocht: Nichts an der wunderbaren Musik auf seinen ersten vier, fünf Platten war je gefährdet, aufregend oder irgendwie ‚relevant‘ zu sein, aber jede hingeworfene Note, jedes gemurmelte Wort dieser müden Musik platzt schier vor Charakter und Persönlichkeit. Wenn ich’s recht bedenke: Mich hat ‚eigen‘ ohnehin immer mehr interessiert als ‚wichtig‘.
Der 1938 als John Weldon Cale geborene Musiker wuchs in Tulsa/Oklahoma auf und zählte in den 1960er Jahren zu den Begründern des so genannten „Tulsa“-Sounds, einer sommerlich-entspannten, gitarrenbetonten und groovigen Mischung aus Rock’n’Roll, Country, Blues, Jazz und diversen karibischen Elementen. Cale’s Markenzeichen wurden in der Folge kurze, sparsam instrumentierte, aber äußerst fein ausgearbeitete Stücke.
J. J. Cale begnügte sich damit, Songs für andere Künstler zu schreiben, die – wie z.B. Tom Petty, Lynyrd Skynyrd und Santana – damit z.T. große Erfolge feiern konnten. Cale selbst schätzte das Dasein in der zweiten oder dritten Reihe sehr und verteidigte sein freies Leben mit mürrisch-bärbeißiger Konsequenz.
Der Wahrheit zuliebe muss man natürlich auch einräumen, dass J. J. Cale seine so geliebte Freiheit in erster Linie seinem größten Mäzen Eric Clapton verdankte, der Songs wie „Cocaine“ und „After Midnight“ weltweit berühmt und damit lukrativ machte. Die jahrzehntelange Freundschaft und kreative Beziehung der beiden gipfelte nach diversen gemeinsamen Konzert-Auftritten schließlich 2006 in dem Album „The Road to Escondido“, das 2008 – völlig zu Recht – mit einem Grammy als „Best Contemporary Blues Album“ ausgezeichnet wurde.
J. J. Cale wird der Rockmusik mehr als andere fehlen, aber auch eher als andere noch lange in Erinnerung bleiben. Dass das nicht nur an der derzeitigen Sommerhitze liegt, in der seine Musik sicher besonders gut zur Geltung kommt, beweisen meines Erachtens u.a. die folgenden Songs aus dem Youtube-Archiv: „Crazy Mama“ ist pure Gelassenheit, „After Midnight“ ein Ausschnitt aus einem gemeinsamen Konzert von J. J. Cale und Eric Clapton, und „Okie“ schließlich die Erkennungsmelodie der legendären 1970er-Jahre-Radiosendung „SWF3-Radioclub“ mit Frank Laufenberg. RIP J. J. Cale.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Wilfried